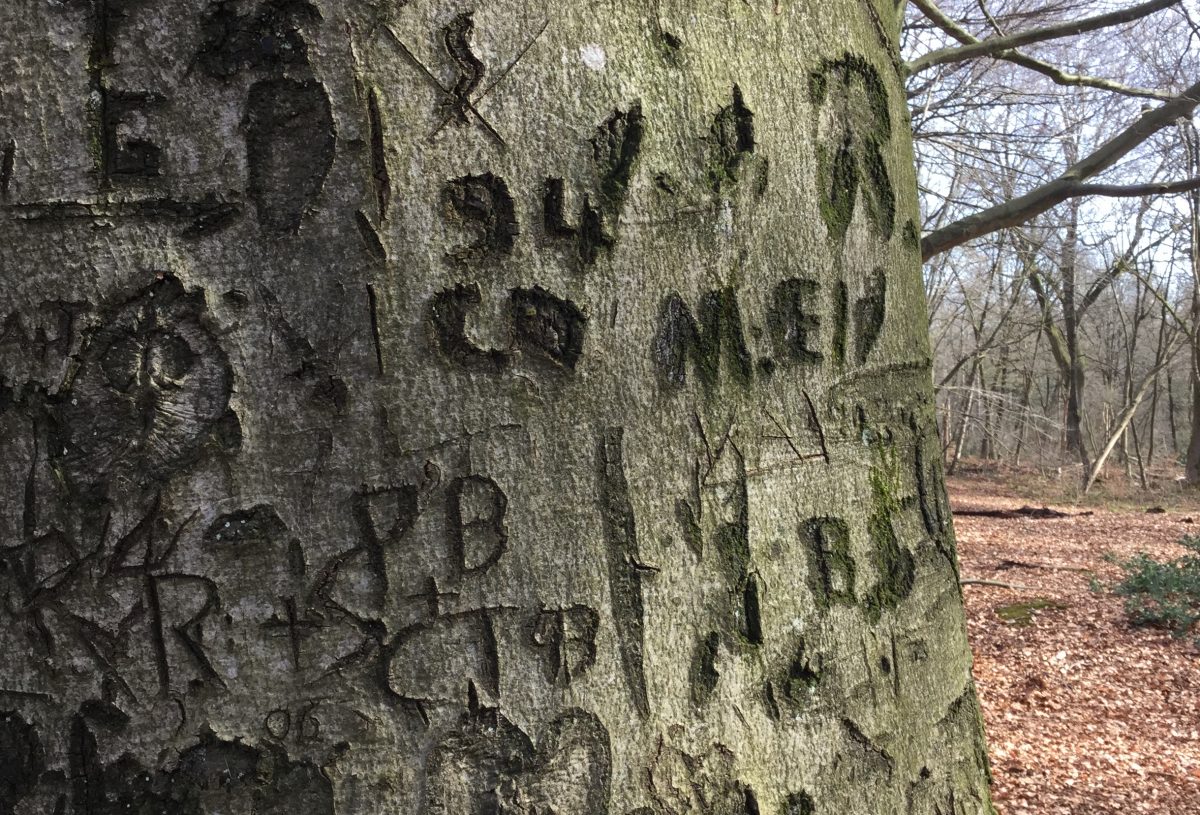Das Folgende sind Facebook-Kommentare zu einer Hohe-Luft-Kolumne.
Wir reden zwar selten von einem „guten Schmerz“ aber die Redewendung „Der Schmerz ist gut“ ist ja durchaus geläufig. An diesem Beispiel wird sichtbar, dass solche Sätze *zugleich* unser Verständnis von „gut“ als auch von der Funktion von Schmerz sichtbar machen. Wenn man jemanden um nähere Erklärung bittet, wird er sagen „Der Schmerz ist gut, weil er dir signalisiert, dass du dich schonen sollst“ oder (bei Muskelkater etwa) „er zeigt dir, dass du ordentlich trainiert hast“. Sätze sind ja oft implizite wechselseitige Bestimmungen ihrer Teile.
Auch in „Das Messer ist gut“ wird zugleich
bestimmt, was „gut“ bedeutet, als auch, was der Zweck des Messers
ist. Diese Sätze haben zudem immer einen Bezug zum Handeln.
In beiden Fällen (Messer und Schmerz) wird das Idealbild des
Dings über eine Funktion, einen Zweck bestimmt. Wird dieser Zweck erfüllt, sagt
man, dass das Ding gut ist.
Menschen haben aber keinen Zweck. Das ist das Problem des
„guten“ Menschen (Freundes, Kochs, Gastgebers). Die Verwendung von
„gut“ in Bezug auf Menschen läuft immer Gefahr, diesen auf Zwecke zu
reduzieren.
Vielleicht ist es gut, sich zu vergegenwärtigen, für welche
Dinge wir „gut“ oder „schlecht“ nie verwenden. Man sagt
nicht: „guter Hügel“ aber man sagt „gute Schi-Piste“. Man
sagt nicht „gutes Meer“ aber „gute Surf-Gegend“ usw. In
„gut“ ist immer „Zweck, Funktion“ impliziert.
Jetzt kann jemand, der dem Schi-Sport und dem Surfen als
Gefahr für die Umwelt grundsätzlich negativ gegenübersteht, sagen: „Eine
Schi-Piste ist niemals gut!“ Was bedeutet das? Für diese Person gibt es
keine Funktion eines Hügels, durch die das Schi-Fahren (durch welches der Hügel
ja zur Schi-Piste wird) auf ihm überhaupt akzeptabel wird.
So ist es auch mit dem Massenmörder.
Nehmen wir den Killer. Es gibt durchaus Gemeinschaften, in
denen der Satz ausgesprochen und sinnvoll sein kann: „Er ist ein guter
Killer“. Für die meisten von uns ist das aber nicht möglich, da wir killen
in keiner Weise als akzeptabel ansehen können. Nur, was überhaupt als Funktion
akzeptabel ist, kann auch gut sein. Wenn ein Schmerz in seiner Signal-Funktion
akzeptabel ist, kann er gut sein (gerade, wenn er nicht gleichzeitig so schlimm
ist, dass er wiederum zum Gesundheitsproblem wird).
Ein weiteres Beispiel wäre der „gute König“: die Rede vom
„guten König“ ist möglich, wenn wir die Existenz von Königen
überhaupt als akzeptabel anerkennen. Demokraten können nicht von „guten
Königen“ reden, ohne das irgendwie einzuschränken.
Was die Menschen betrifft, denke ich, dass die passende
Verwendung von „gut“ von der Vielfalt der Rolle abhängt, die wir da
nennen. Beim Killer und beim König ist es noch einfach, beim Gastgeber und beim
Freund wird es schwieriger, und beim Menschen schlechthin fast aussichtslos,
das definitorisch festzuhalten. Trotzdem können wir „gut“ hier
verwenden. Aber eigentlich ist das immer erläuterungsbedürftig.
Ich spreche nie von „guter Kunst“, und ich würde
nicht sagen, dass ein Ding ein „gutes Messer“ ist, wenn ich es
ästhetisch ansprechend finde. Im Gegenteil: Ich würde sagen: Das Ding kein
gutes Messer, aber es sieht gut aus. Gutes Aussehen ist schon wieder
Zweck/Funktion-orientiert: Es befriedigt meine ästhetischen Bedürfnisse in
adäquater Weise. Bei der Meditation und dem Muße-Finden gibst du selbst schon
den Zweck an, den sie erfüllen, wenn du sie „gut“ nennst.
Ich möchte nochmal betonen, dass ich diese alltägliche
Verwendungsweise und das alltägliche Verständnis von „gut“ nicht
verteidige, sondern problematisiere, insbesondere, wenn es auf Menschen und auf
ihr (moralisch zu beurteilendes) Verhalten bezogen wird. Aber zu diesem
Problematisieren gehört das möglichst genaue Beschreiben des tatsächlichen
Sprachgebrauchs.
Es gibt eine Reihe von Werturteilsbezeichnungen, z.B. wahr
und falsch, schön und hässlich, gelungen und misslungen, angenehm und
unangenehm. Mit gut und schlecht bezeichnen wir eine bestimmte Art von Wertdifferenzierung,
und diese interessiert mich hier. Von mir aus kannst du gern nur
„gut“ und „schlecht“ für alles möglich verwenden, dann
verzichtest du aber auf die Möglichkeiten der Sprache.
Und ich bin auch der Meinung, dass man Begriffe auch immer
sprachlich klären kann und dies auch versuchen sollte, „mach es selbst und
du wirst es merken“ reicht dafür nicht aus, weil eben auch die positive
Erfahrung einer Praxis sehr unterschiedlich sein kann, was ein schönes Messer
von einem guten unterscheidet, merkt man zwar beim Schneiden und Ansehen und
dann muss man sprachlich klären, was das Gute und was das Schöne an der
Messer-Erfahrung war.
Natürlich reden wir dauernd irgendwie und erstaunlicherweise
verstehen wir uns dabei auch noch. Die Sprache ist voll von Äquivokationen,
Doppel- und Mehrfachbedeutungen. So kann man jeder philosophischen Diskussion
über die Frage, Was „gut“ denn im Kern bedeutet, ausweichen. Da habe
ich auch nichts dagegen, aber wenn man einen Text kommentiert, der zu einer
solchen Diskussion anregen will, dann scheint es mir irgendwie kontraproduktiv,
darauf zu beharren, dass man selbst auch mal „gutes Wetter“ und
„gutes Buch“ sagt (und damit nicht meint, dass das Ding in idealer
Weise den Vorstellungen von diesem Begriff entspricht).
Man wird nicht den Kern eines Begriffs bestimmen können,
wenn man in einer unendlich vielfältigen Sprache versucht, eine Definition zu
finden, die alle möglichen Verwendungen eines Wortes umfasst. Man muss dann eben
diese Verwendungen mit reflektieren.